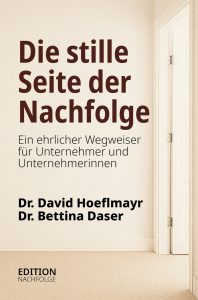Was ist „nicht betriebsnotwendiges Vermögen“?
Unter nicht betriebsnotwendigem Vermögen versteht man alle Vermögenswerte eines Unternehmens, die für den laufenden operativen Geschäftsbetrieb nicht erforderlich sind. Das Unternehmen könnte seinen Zweck also auch ohne diese Werte erfüllen. Häufig werden solche Werte aus steuerlichen Gründen im Unternehmen belassen und sammeln sich im Laufe der Jahre an. Typische Beispiele sind:
- Überschüssige Liquidität – also Bankguthaben weit über dem, was für das Tagesgeschäft und als Betriebsmittel nötig ist.
- Immobilien im Besitz der Firma, die nicht selbst genutzt werden – etwa an Dritte vermietete Grundstücke oder Gebäude.
- Wertpapierdepots oder Beteiligungen an anderen Unternehmen, die dem operativen Geschäft nicht dienen.
- Liebhabereien auf der Bilanz – zum Beispiel Oldtimer, Kunstwerke oder sonstiges Anlagevermögen.
- Luxusfahrzeuge, Ferienimmobilien oder ähnliche Vermögenswerte, die über die Firma gehalten, aber privat genutzt werden.
Grundsätzlich gilt: Nicht betriebsnotwendig ist, was für die Erzielung der Erträge und die Erfüllung des Unternehmenszwecks nicht gebraucht wird.
Warum kann das beim Verkauf zum Problem werden?
Wenn ein Unternehmen verkauft wird, stellt sich plötzlich die Frage: Was gehört „wirklich“ zum Unternehmen – und was nicht? Genau hier kann nicht betriebsnotwendiges Vermögen zum Knackpunkt werden.
- Käufer wollen kein „Geld für Geld“ zahlen: Sie interessieren sich primär für das operative Geschäft. Überschüsse treiben den Kaufpreis in die Höhe, ohne die Geschäftstätigkeit zu stärken.
- Verkäufer erwarten dennoch einen Gegenwert: Verkäufer betrachten diese Werte als Teil ihres Vermögens und möchten sie oft im Kaufpreis berücksichtigt sehen.
- Steuerliche und rechtliche Komplexität: Wird nicht betriebsnotwendiges Vermögen mitverkauft, kann dies steuerlich oder rechtlich nachteilig sein, insbesondere bei Share Deals.
- Erschwerte Finanzierung: Banken finanzieren lieber operative Assets. Je höher der Anteil an nicht betriebsnotwendigem Vermögen, desto schwieriger die Finanzierung.
Die Folge: Unklarheiten und unterschiedliche Erwartungen können den Deal belasten oder sogar gefährden.
Drei Handlungsoptionen im Umgang mit überschüssigem Vermögen
1. Vorabentnahme ins Privat- oder Holdingvermögen
Oft ist es ratsam, nicht betriebsnotwendige Werte noch vor dem Verkauf aus der Firma herauszunehmen.
Das kann geschehen durch:
- Ausschüttung überschüssiger Liquidität als Dividende
- Übertragung einzelner Assets an die Gesellschafter
- Strukturierte Umwandlung, z. B. durch Ausgliederung in eine eigene Gesellschaft
Wichtig ist eine vorausschauende steuerliche Planung. Wer unüberlegt entnimmt, riskiert hohe Steuern auf stille Reserven oder Ausschüttungen. Wer frühzeitig plant, kann durch Umstrukturierungen oder Holdinglösungen steuerlich optimieren.
2. Separate Bewertung und Kaufpreis-Adjustierung
Manchmal ist es sinnvoll, das Vermögen im Unternehmen zu belassen, es aber separat zu bewerten. Das operative Geschäft und die „Extras“ werden getrennt erfasst und verhandelt. So lässt sich klar darstellen, welcher Kaufpreisanteil auf das Kerngeschäft und welcher auf zusätzliche Werte entfällt. Wichtig ist eine saubere Dokumentation, damit später keine Streitigkeiten entstehen.
3. Bewusste Mitveräußerung
In bestimmten Fällen kann es strategisch sinnvoll sein, ein eigentlich nicht betriebsnotwendiges Asset mitzuverkaufen – etwa eine Immobilie, die der Käufer für Wachstum benötigt. Dann sollte das Vermögen ausdrücklich Teil der Transaktion sein, mit klarer Kaufpreisaufteilung und vertraglicher Festlegung.
Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Der Umgang mit nicht betriebsnotwendigem Vermögen hat erhebliche steuerliche Auswirkungen:
- Rechtsform und Verkaufsart: Je nach Share Deal oder Asset Deal entstehen unterschiedliche Steuerfolgen. Kapitalgesellschaften profitieren oft von Beteiligungsfreistellungen, während Privatpersonen meist im Teileinkünfteverfahren besteuert werden.
- Carve-out und Umstrukturierung: Durch Spaltungen oder Ausgliederungen lassen sich Vermögenswerte steuerneutral in separate Einheiten übertragen. Das erfordert sorgfältige Planung und oft längere Vorlaufzeiten.
- Holding-Struktur: In manchen Fällen kann eine vorgelagerte Holding steuerlich vorteilhaft sein, da Gewinne aus Anteilsverkäufen dort weitgehend steuerfrei realisiert werden können.
Wichtig: Steuerliche Gestaltungen müssen frühzeitig vorbereitet und sauber dokumentiert werden, sonst droht eine hohe Belastung.
Emotionale Komponente: Warum es so schwerfällt
Viele Unternehmer hängen emotional an Vermögenswerten, die über Jahre in der Firma verblieben sind. Oldtimer, Immobilien oder Wertpapierdepots fühlen sich „wie Teil des Lebenswerks“ an. Doch aus Sicht des Käufers sind sie Ballast.
Hier hilft es, sich klarzumachen: Das Lebenswerk ist das operative Unternehmen. Private Rücklagen gehören in die private Vermögenssphäre. Wer das trennt, sorgt für Klarheit – und steigert die Chancen auf einen reibungslosen Verkauf.
Keine Überraschungen – rechtzeitig klären
Am besten analysieren Sie lange vor dem Verkaufsprozess, welche Vermögenswerte nicht operativ gebraucht werden. Bereinigen Sie die Bilanz, schaffen Sie Transparenz und binden Sie frühzeitig Ihren Steuerberater und M&A-Experten ein.
So vermeiden Sie, dass in der Due Diligence plötzlich Fragen auftauchen, die Zeit, Geld und Vertrauen kosten. Käufer schätzen klare Verhältnisse und honorieren eine saubere Vorbereitung mit mehr Vertrauen – und oft auch mit einem besseren Preis.
Fazit
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen muss kein Dealbreaker sein – wenn Sie es rechtzeitig identifizieren und klug damit umgehen. Ob Vorabentnahme, separate Bewertung oder bewusste Mitveräußerung: Wichtig ist, dass Klarheit herrscht.
Ein transparenter Umgang signalisiert Professionalität, reduziert Risiken und schafft die Grundlage für einen erfolgreichen Verkauf – fair und vorteilhaft für beide Seiten.