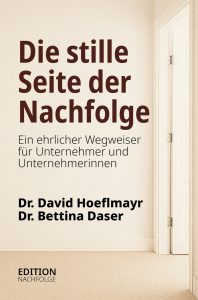Wer ein Kaufpreisangebot für sein Unternehmen erhält, liest häufig die Begriffe „Cash-Free und Debt-Free“. Diese kleine Phrase hat große Auswirkungen auf den finalen Kaufpreis und lässt Raum für Verhandlung – und Missverständnisse. Lassen Sie uns die Grundlagen dieses Konzepts und die wesentlichen Überlegungen dahinter genauer beleuchten.
Was bedeutet „Cash-Free und Debt-Free“?
Im Kern besagt die „Cash-Free und Debt-Free“-Klausel, dass der Kaufpreis eines Unternehmens unter der Annahme berechnet wird, dass das Unternehmen schuldenfrei („Debt-Free“) und ohne nicht betriebsnotwendige Liquidität („Cash-Free“) übergeben wird. Doch diese scheinbar simple Idee hat ihre Tücken, wie das folgende Beispiel zeigt.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung
Betrachten wir zwei identische Unternehmen, A und B, die jeweils einen Wert von 10 Mio. € haben. Beide sind profitabel, gut aufgestellt und technologisch modern ausgestattet. Der einzige Unterschied:
- Unternehmen A: Die Gewinne wurden im Unternehmen belassen und Maschinen wurden aus Eigenkapital finanziert.
- Unternehmen B: Die Gewinne wurden ausgeschüttet, und die Maschinen wurden durch einen Kredit in Höhe von 3 Mio. € finanziert.
Hier greift der „Debt-Free“-Gedanke: Der Kaufpreis von Unternehmen A bleibt bei den 10 Mio. €, während der Preis für Unternehmen B um die Verbindlichkeiten reduziert wird – also auf 7 Mio. € (10 Mio. € – 3 Mio. €). Dies zeigt, dass die Verbindlichkeiten direkt den Kaufpreis beeinflussen.
Die Details der Verbindlichkeiten („Debt-Free“)
Was zählt nun genau als „Debt“? Auf den ersten Blick scheint die Sache klar: Verbindlichkeiten gegenüber Banken sind offenkundig abzuziehen. Doch oft wird es komplexer. Was ist mit Leasingverträgen, Mietkaufvereinbarungen, Factoring-Verbindlichkeiten, Gesellschafterdarlehen, Pensionsrückstellungen, oder sogar Steuerverbindlichkeiten? Diese Punkte müssen klar definiert und häufig im Kaufvertrag detailliert verhandelt werden, da sie den finalen Kaufpreis erheblich beeinflussen können.
„Cash-Free“ – Liquidität im Unternehmen
Unter „Cash-Free“ versteht man, dass das nicht betriebsnotwendige Geld (z. B. Kassenbestände und Bankguthaben) dem Kaufpreis hinzugerechnet wird. Doch auch hier gibt es Verhandlungsbedarf, da definiert werden muss, welcher Teil der Liquidität tatsächlich nicht betriebsnotwendig ist. Zum Beispiel könnten Finanzanlagen oder geldähnliche Vermögensgegenstände ebenfalls hinzugerechnet oder ausgenommen werden.
Für Unternehmen, deren Liquidität stark schwankt, kann dies besonders knifflig sein. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Kassenstände kurz vor dem Verkauf zu optimieren – sei es durch eine verzögerte Materialbestellung oder eine verspätete Kundenabrechnung. Um solche Schwankungen auszugleichen, wird in der Regel eine „Working Capital Normalisierung“ vorgenommen, die den Durchschnittswert des Umlaufvermögens ermittelt.
Fazit: „Cash-Free & Debt-Free“ macht den Unternehmensverkauf komplex
Die „Cash-Free & Debt-Free“-Klausel ist ein zentrales Element bei Unternehmensverkäufen, und die meisten Käufer bestehen auf dieser Regelung. Für eine erste Einschätzung können die Bankverbindlichkeiten vom Unternehmenswert abgezogen werden. Doch für die Details und die individuelle Ausgestaltung ist professionelle Unterstützung unverzichtbar.
Möchten Sie mehr erfahren oder haben Fragen zu „Cash-Free & Debt-Free“ in Ihrem Verkaufsprozess? Lassen Sie uns darüber sprechen!