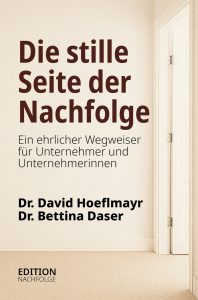Immobilie beim Unternehmensverkauf – unterschätzter Erfolgsfaktor
Viele Unternehmer, die über den Verkauf ihres Unternehmens nachdenken, stehen vor einer entscheidenden Zusatzfrage: Was passiert mit der Betriebsimmobilie?
Soll sie gemeinsam mit dem Unternehmen verkauft werden? Oder ist es klüger, die Immobilie im Besitz zu behalten, zu vermieten oder separat zu veräußern?
Die Antwort ist nicht trivial. Denn die Immobilie beeinflusst nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die Steuern, die Attraktivität für Käufer und die strategische Flexibilität des Verkäufers. In diesem Beitrag finden Sie eine detaillierte Analyse – aus Verkäufersicht –, die Ihnen hilft, die optimale Lösung für Ihre Nachfolge zu finden.
1. Wie die Immobilie in der Unternehmensbewertung berücksichtigt wird
Ertragswertmethode:
Bei ertragsorientierten Bewertungsverfahren (Ertragswert oder DCF) wird eine betrieblich genutzte Immobilie je nach ihrer Betriebsnotwendigkeit unterschiedlich berücksichtigt. Ist die Immobilie betriebsnotwendig (z. B. Produktionshalle, unbedingt erforderlich für den Geschäftsbetrieb), fließen ihre Nutzungskosten in die Plan-Gewinne bzw. Cashflows ein (etwa durch Abschreibungen, Instandhaltungskosten oder eine kalkulatorische Miete). Nicht betriebsnotwendige Immobilien (z. B. überschüssige Grundstücke oder Gebäude, die für den operativen Betrieb nicht gebraucht werden) werden hingegen separat bewertet und dem Unternehmenswert zusätzlich hinzuaddiert. Damit stellt man sicher, dass auch zusätzlicher Immobilienwert berücksichtigt wird, der im reinen Ertragswert sonst nicht voll zur Geltung käme. In der Praxis wird hierzu oft ein separates Immobiliengutachten (z. B. nach dem Ertragswertverfahren der Immobilienwertermittlung) erstellt und zum Wert des operativen Geschäfts addiert. Hintergrund ist, dass Immobilien als weniger risikobehaftet gelten als das Kerngeschäft – entsprechend würden Investoren für Immobilien einen höheren Wert je Ertragseinheit ansetzen als für das Unternehmen. Wird die Immobilie zusammen mit dem Betrieb bewertet, kann es daher passieren, dass ihr Wert im Gesamtpaket mit einem zu hohen Risikoabschlag belegt wird und nicht vollständig eingepreist wird. Aus Verkäufersicht ist es daher wichtig, im Ertragswertverfahren klar zwischen operativem Ertrag und immobilienbedingtem Ertrag zu trennen und gegebenenfalls mit marktüblichen Mieten zu kalkulieren, um den Immobilienwert transparent zu machen.
Substanzwertmethode:
Die Substanzwertmethode ermittelt den Wert eines Unternehmens anhand der Summe seiner Vermögensgegenstände abzüglich Schulden (Substanz/Substanzwert). Hier geht die Immobilie mit ihrem aktuellen Zeit- bzw. Verkehrswert in voller Höhe in die Bewertung ein. Gerade bei mittelständischen Unternehmen mit hoher Anlagenintensität (Immobilien, Maschinen, Lagerbestände etc.) ist das Substanzwertverfahren ein wichtiges Korrektiv. Es liefert eine Wertuntergrenze und spiegelt stille Reserven wider. Im Beispiel eines immobilienlastigen Unternehmens kann der Substanzwert deutlich über dem reinen Ertragswert liegen, was dem Verkäufer signalisiert, dass ein Kaufinteressent zumindest die werthaltigen Assets bezahlen sollte. Allerdings bleibt zu beachten, dass ein Käufer nur dann bereit sein wird, über den Ertragswert hinauszugehen, wenn er entweder selbst eine Nutzung für die Immobilie hat oder der Marktwert der Immobilie durch andere Nutzungen/Rendite erzielt werden kann.
Kombinationsansätze:
In der Praxis wird oft ein Mittelwertverfahren oder eine angepasste Ertragswertmethode angewandt, um sowohl Ertragskraft als auch Substanz zu berücksichtigen. Beispielsweise kann man den ermittelten Ertragswert und Substanzwert mit Gewichten mischen (z. B. 75 % Ertragswert, 25 % Substanzwert). Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass ein Unternehmen neben seiner zukünftigen Ertragskraft auch über substanzielle Vermögenswerte (wie Immobilien) verfügt. Ein solcher kombinierter Ansatz ist besonders dann sinnvoll, wenn die Immobilien einen erheblichen Wert darstellen, der durch die Ertragskraft allein nicht abgebildet würde. Außerdem wird dadurch vermieden, dass stille Reserven (z. B. ein Grundstück, das seit Jahrzehnten in der Bilanz steht) unberücksichtigt bleiben. Zusammenfassend gilt: Die Unternehmensbewertung sollte die Betriebsimmobilie entweder implizit (über die Cashflows bei betriebsnotwendiger Nutzung) oder explizit (als separater Vermögenswert) berücksichtigen, damit Verkäufer und Käufer ein realistisches Bild vom Unternehmenswert inklusive Immobilie erhalten.
2. Verkauf der Immobilie mit dem Unternehmen – wann sinnvoll?
Ob die Betriebsimmobilie mitverkauft werden sollte, hängt von mehreren strategischen, finanziellen und steuerlichen Überlegungen ab. Im Folgenden die wichtigsten Pro– und Contra-Aspekte aus Sicht des Verkäufers:
Vorteile, wenn Immobilie mit dem Unternehmen verkauft wird
- Einfache Transaktion: Ein gemeinsamer Verkauf bedeutet „alles aus einer Hand“ zu übertragen. Der Verkäufer kann Schlüssel für Firma und Gebäude gleichzeitig übergeben und sich vollständig zurückziehen. Das erspart dem Verkäufer die Rolle eines zukünftigen Vermieters und reduziert langfristige Verflechtungen mit dem Unternehmen.
- Liquide Mittel und Entschuldung: Durch den Verkauf der Immobilie fließt zusätzliches Kapital. Dies kann für den Verkäufer wichtig sein, um Schulden zu tilgen oder die Altersvorsorge aufzustocken. Eine Betriebsimmobilie stellt oft einen erheblichen Vermögenswert dar – wird er separat behalten, steckt das Kapital weiter im Objekt. Der Verkauf bringt Liquidität und verringert das Klumpenrisiko, das mit Immobilieneigentum verbunden ist.
- Vermeidung komplizierter Vermieterrolle: Bleibt die Immobilie im Besitz des Verkäufers, geht dieser in ein langfristiges Mietverhältnis mit dem Käufer ein. Viele Verkäufer scheuen die damit verbundenen Abhängigkeiten und potentiellen Konflikte (etwa über Mietanpassungen, Instandhaltung, Investitionen ins Gebäude). Ein vollständiger Verkauf erspart diese Problematik, vor allem wenn der Verkäufer einen sauberen Schnitt für den Ruhestand wünscht.
- Steuerlich glatt bei Share Deal (Kapitalgesellschaft): Befindet sich die Immobilie ohnehin im Betriebsvermögen der zu verkaufenden Firma (z. B. bei einer GmbH) und werden die Geschäftsanteile verkauft (Share Deal), geht die Immobilie quasi automatisch mit über, ohne einen separaten Immobilienverkauf auszulösen. In so einem Share Deal fällt für den Käufer keine Grunderwerbsteuer auf einen separaten Grundstückskauf an; beim Verkäufer wird – je nach Rechtsform – der Anteilsertrag besteuert (z. B. Teileinkünfteverfahren für Privatpersonen oder weitgehende Steuerfreistellung bei Körperschaften). Auch entfällt die Notarpflicht für einen separaten Grundstückskaufvertrag, was den Transaktionsaufwand reduziert.
Nachteile und Risiken des gemeinsamen Verkaufs
- Begrenzte Käufergruppe & Finanzierungshürde: Nicht jeder Käufer will oder kann eine teure Immobilie miterwerben. Die Übernahme der Immobilie erhöht den Kaufpreis deutlich und verlangt mehr Eigenkapital oder Fremdfinanzierung. Viele Käufer – insbesondere Nachfolger mit begrenzten finanziellen Mitteln – bevorzugen ein „asset-light“-Modell, also nur den Kauf des operativen Geschäfts und stattdessen einen Mietvertrag für die Immobilie. Durch das große Investitionsvolumen (Unternehmen + Immobilie) sinkt die Zahl potenzieller Käufer und die Transaktion kann länger dauern oder gar scheitern.
- „Paketabschlag“ beim Verkaufspreis: Wird das Unternehmen inklusive Immobilie verkauft, besteht die Gefahr eines Preisnachlasses für das Gesamtpaket. Käufer bewerten das Paket nicht notwendigerweise als Summe der Einzelwerte, sondern orientieren sich an der Ertragskraft des Unternehmens als Ganzes. Ist die Immobilie sehr wertvoll, aber die Firma wirft im Verhältnis dazu geringe Erträge ab, wird der Käufer den Kaufpreis vermutlich deckeln, da die Firmenerträge die Finanzierung beider Teile nicht tragen können. Für den Verkäufer heißt das: Im Paketverkauf droht ein Abschlag – die Immobilie bringt unter Umständen weniger ein, als wenn sie separat zum Marktwert veräußert würde.
- Steuerliche Nachteile in bestimmten Konstellationen: Ist die Immobilie im Privatvermögen des Inhabers (oder z. B. einer separaten Besitzgesellschaft) und würde mit der Firma verkauft, ginge das in der Regel nur über einen separaten Immobilien-Asset-Deal einher. Ein solcher Immobilienverkauf kann steuerlich ungünstig sein: Bei weniger als 10 Jahren Haltedauer wäre der Veräußerungsgewinn voll steuerpflichtig, inkl. Aufdeckung stiller Reserven; zudem fällt Grunderwerbsteuer beim Käufer an. Käufer werden daher versuchen, den Kaufpreisanteil der Immobilie niedrig anzusetzen, was wiederum dem Verkäufer schadet, wenn er die Immobilie versteuern muss. Auch die Abschreibungsmöglichkeiten sind für den Käufer begrenzt (Gebäudewert jährlich nur 2–3 % abschreibbar, Grundstück gar nicht), was aus Käufersicht ein weiterer Grund ist, weniger für die Immobilie zu zahlen.
- Geringere strategische Flexibilität: Veräußert der Verkäufer auch die Immobilie, gibt er damit dauerhaft einen Standort auf. Sollte er – etwa für Familienmitglieder oder einen späteren Wiedereinstieg – die Immobilie selbst nutzen oder entwickeln wollen, ist diese Option vom Tisch. Ebenso entfällt eine mögliche dauerhafte Mietrendite als langfristiges Einkommen. Mit anderen Worten: Der Verkäufer tauscht zwar Sachwert gegen Geld, verzichtet aber auf künftige Wertsteigerungen der Immobilie und die Option, das Objekt später anderweitig zu verwenden.
Zwischenfazit: Ein gemeinsamer Verkauf von Unternehmen und Immobilie ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Immobilie betriebsnotwendig und eng mit dem Geschäftsmodell verknüpft ist, der Käufer bereit und finanziell fähig ist, beides zu übernehmen, und keine erheblichen steuerlichen Fallstricke lauern. Ist hingegen die Immobilie eher ein separater Vermögenswert (z. B. beliebig vermietbares Gewerbeobjekt) oder bestehen steuerliche Sperrfristen/Vorteile bei getrenntem Verkauf, sollte man sorgfältig prüfen, ob ein getrennter Weg nicht vorteilhafter ist. Oft läuft es auf einen Kompromiss hinaus: Verkäufer und Käufer einigen sich auf einen Unternehmensverkauf ohne Immobilie, verbunden mit einem langfristigen Mietvertrag – und ggf. einer Option, die Immobilie später doch zu übernehmen (siehe Alternativen).
3. Alternativen zum Verkauf der Immobilie mit dem Unternehmen
Wenn ein Mitverkauf der Betriebsimmobilie nicht optimal ist, stehen mehrere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung:
a) Herauslösung der Immobilie (Carve-out)
Die Immobilie wird vor dem Unternehmensverkauf aus dem Betriebsvermögen gelöst. Praktisch: Übertragung auf den Unternehmer privat oder auf eine neu gegründete Besitzgesellschaft. Befand sich die Immobilie bisher im zu veräußernden Unternehmen (z. B. GmbH-Bilanz), muss sie vor dem Verkauf entweder an den Verkäufer/Investoren verkauft oder entnommen/ausgeschieden werden. Das erfordert sorgfältige Planung, da steuerlich schnell stille Reserven aufgedeckt werden können. Häufig wird dieser Schritt Jahre vor dem geplanten Verkauf eingeleitet, um steuerlich optimierte Bedingungen zu schaffen (z. B. Fristen, Haltezeiten).
Effekte: Das operative Unternehmen wird „immobilienfrei“, der Unternehmensverkauf schlanker. Der Käufer erwirbt nur die Firma; die Immobilie wird separat gehalten oder verkauft. Sinnvoll, wenn die Immobilie nicht betriebsnotwendig ist oder ohne größere Nachteile vom Betrieb getrennt werden kann. Oft kann die Immobilie separat an einen Immobilieninvestor veräußert werden, der einen höheren Preis (niedrigere Renditeerwartung) zahlt als ein Unternehmenskäufer.
Vorteile: Potenzial zur Maximierung des Immobilienerlöses; größere Käuferzielgruppe für die Firma; Flexibilität (späterer steueroptimierter Verkauf oder Vermietung).
Nachteile: Zusätzlicher Aufwand (Abspaltung, Notar, Grundbuch, Steuerberatung); eventuelle sofortige Steuerlast bei Entnahme/Verkauf aus dem Betriebsvermögen; erfordert frühzeitige Planung; Käufer muss mit der Mietlösung einverstanden sein.
b) Sale-and-Lease-Back
Der Eigentümer verkauft die Immobilie an einen Investor (oder die Käufergesellschaft) und schließt gleichzeitig einen langfristigen Mietvertrag ab. Das kann vor, während oder nach dem Firmenverkauf erfolgen.
- Vor dem Unternehmensverkauf: Verkauf der Immobilie an einen Drittinvestor, Rückmiete an das eigene Unternehmen. Ergebnis: Kapitalzufluss vor dem Firmenverkauf, die Firma wird „asset-light“, der spätere Unternehmensverkauf wird einfacher (Käufer übernimmt ein Unternehmen mit Mietvertrag, nicht mit Immobilieneigentum).
- Im Zuge des Unternehmensverkaufs: Käufer erwirbt zunächst Immobilie mit und veräußert sie unmittelbar weiter an einen Leasing-Investor; parallel Mietvertrag. Ergebnis: Käufer reduziert seine Kapitalbindung; Verkäufer monetarisiert die Immobilie im Rahmen der Transaktion.
Vorteile: Kapitalfreisetzung bei gleichzeitigem Weiterbetrieb am selben Standort; Mietzahlungen sind beim Unternehmen steuerlich abzugsfähig; der Unternehmensverkauf wird für Käufer finanzierbarer.
Nachteile: Verlust der Objektkontrolle; langfristige Mietverpflichtungen (Indexierung); zu hohe Miete kann die Ertragslage und damit den Unternehmenswert drücken; steuerliche Effekte aus dem Immobilienverkauf sind zu beachten; höhere Transaktionskomplexität.
c) Übertragung ins Privatvermögen vor dem Verkauf
Die Immobilie wird aus dem Betriebsvermögen ins Privatvermögen überführt – idealerweise lange vor dem Verkauf. Motivation: Im Privatvermögen können nach 10 Jahren Haltedauer Veräußerungsgewinne steuerfrei sein. Außerdem wird die Immobilie nicht automatisch Teil eines Share Deals.
Stolpersteine: Die Entnahme aus dem Betriebsvermögen gilt steuerlich als Veräußerung zum Teilwert: stille Reserven werden sofort aufgedeckt und sind zu versteuern – ohne, dass notwendigerweise Liquidität zufließt. Ohne saubere Planung kann das teuer werden. Geeignete Gestaltungen (z. B. Nutzung von Reinvestitionsrücklagen, Besitzgesellschaften) sind individuell zu prüfen.
Fazit: Eine steuergetriebene Alternative, die sich vor allem lohnt, wenn genug Zeit bleibt, die Immobilie bis zum Verkauf steuerentspannt zu halten, und wenn der Verkäufer die Immobilie ohnehin persönlich weiter nutzen oder vermieten möchte.
d) Behalten und Vermieten an den Erwerber
Der Verkäufer behält die Immobilie und vermietet sie langfristig an den Unternehmensnachfolger. Häufige Lösung in der Praxis: regelmäßige Mieteinnahmen als Altersvorsorge, während der Käufer nur das operative Geschäft finanziert.
Vorteile: Stabile Cashflows aus Miete; Eigentum an einem Sachwert mit möglicher Wertsteigerung; späterer Verkauf weiterhin möglich (z. B. an den Käufer oder an einen Dritten). Finanzierung des Unternehmens für Käufer wird leichter.
Nachteile: Langfristige Abhängigkeiten zwischen Verkäufer (Vermieter) und Käufer (Mieter); Klumpenrisiko (oft Ein-Mieter-Objekt); Vermieterpflichten und Verwaltungsaufwand; Investitionen/Erweiterungen des Käufers am Standort können schwieriger sein. Steuerliche Effekte im Zuge der Entflechtung (Betriebsaufspaltung etc.) sind zu beachten.
Gestaltungsbausteine: Häufig werden Kaufoptionen zugunsten des Käufers vereinbart (fest definierter Preis oder Preisformel, z. B. nach 5/10 Jahren), um Investitionssicherheit zu schaffen. Ein solider Mietvertrag (lange Laufzeit, Indexierung, Verlängerungsoptionen, Sicherheiten) ist entscheidend – er bestimmt auch den späteren Marktwert der Immobilie, falls diese separat verkauft wird.
4. Bewertung der Handlungsalternativen und Entscheidungsfindung
Für die Wahl der optimalen Lösung sollten die folgenden Kriterien strukturiert bewertet werden:
1) Steuerliche Wirkung
Jede Option hat andere Steuerfolgen. Direktverkauf der Immobilie im Betriebsvermögen kann sofort steuerpflichtige Gewinne auslösen. Verkauf aus Privatvermögen kann nach 10 Jahren steuerfrei sein. Herauslösung ins Privatvermögen birgt die Gefahr der sofortigen Aufdeckung stiller Reserven, bietet aber langfristig Gestaltungsspielraum. Sale-and-Lease-Back löst im Zeitpunkt des Verkaufs Steuern aus, verteilt aber die Effekte auf zwei Transaktionen. Wichtig ist die Zeitkomponente (sofort vs. später) und die Gesamt-Netto-Steuerlast. Frühzeitig steuerlichen Rat einholen.
2) Kaufpreisoptimierung
Ziel ist die Maximierung des Gesamterlöses: Separater Immobilienverkauf an einen Immobilieninvestor bringt oft höhere Multiples (niedrigere Renditeerwartung) als der Paketverkauf mit dem Unternehmen. Die Aufteilung in zwei Verkäufe (Firma und Immobilie) kann insgesamt mehr einbringen als ein Paketverkauf, bei dem ein „Paketabschlag“ droht. Andererseits schätzen manche Käufer das Komplettpaket und sind bereit, dafür zu zahlen. Auch Timing und Marktrisiko berücksichtigen.
3) Flexibilität für Nachfolge und Strategie
Für den Verkäufer: Immobilie behalten = Optionen behalten (Miete, Wertsteigerung, spätere Nutzung).
Für den Käufer: Erwerb ohne Immobilie = höhere Flexibilität (Standortwechsel möglich), aber geringere Standortkontrolle. Kaufoptionen können Investitionssicherheit schaffen. Trennung kann spätere Weitergaben/Weiterverkäufe erleichtern.
4) Komplexität und Aufwand
Herauslösung, Sale-and-Lease-Back, Optionen: mehr Vertragswerke, mehr Parteien, mehr Verhandlungspunkte. Gemeinsamer Verkauf ist prozessual am geradlinigsten. Frage: Rechtfertigt der Mehrwert (steuerlich/finanziell) den Mehraufwand?
5) Finanzierung und Käuferperspektive
Mit-Immobilie steigt die Kapitalbindung und damit die Finanzierungshürde. Trennung (Miete) verbessert oft die Finanzierbarkeit des Deals und erweitert die Käuferzielgruppe (insb. Management-/Familiennachfolger). Aus Verkäufersicht: Welche Struktur macht den Deal für den idealen Käufer am tragfähigsten?
Vorgehen in der Praxis:
Erstellen Sie eine Options-/Kriterien-Matrix und bewerten Sie 2–3 Szenarien mit Zahlen (Kaufpreise, Steuern, Zeitplan, Komplexität). Beispiel-Szenarien:
- S1: Gesamtkauf durch strategischen Käufer (ein Vertrag, evtl. Paketabschlag, schnelle Abwicklung).
- S2: Trennung + Vermietung + spätere Kaufoption (höherer Gesamterlös, breitere Käufergruppe, mehr Komplexität).
- S3: Sale-and-Lease-Back vor Verkauf (Liquidität jetzt, „asset-light“ beim Verkauf, steuerliche Effekte sofort).
Keine Pauschallösung passt immer – individuelle Faktoren (Branche, Standort, Immobilienmarkt, Familienziele) sind entscheidend.
Fazit: Wie Sie die richtige Entscheidung für Ihre Immobilie treffen
Die Betriebsimmobilie ist beim Unternehmensverkauf weit mehr als nur ein „Nebenthema“. Sie beeinflusst Kaufpreis, Steuern, Käuferkreis und Ihre eigene Zukunftsgestaltung.
- Wenn die Immobilie betriebsnotwendig und eng mit dem Geschäft verbunden ist, spricht vieles für den Mitverkauf.
- Wenn sie jedoch ein eigenständiger Vermögenswert ist, lohnt es sich meist, über Alternativen wie Herauslösung, Vermietung oder einen separaten Verkauf nachzudenken.
- Am Ende zählt der individuelle Mix aus Steueroptimierung, Kaufpreismaximierung, Flexibilität und Machbarkeit.
Unternehmer sollten deshalb frühzeitig – am besten mehrere Jahre vor der geplanten Übergabe – mit Steuerberatern und M&A-Experten Szenarien durchspielen. So bleibt genug Zeit, steuerliche Fristen auszunutzen und die Immobilie strategisch optimal zu platzieren.
Mein Tipp: Betrachten Sie Immobilie und Unternehmen stets getrennt und prüfen Sie mehrere Szenarien. So erkennen Sie, welche Struktur am besten zu Ihrem Lebensziel, Ihrer finanziellen Situation und den Marktbedingungen passt.
Lassen sie uns reden.
Sie überlegen, Ihr Unternehmen zu verkaufen und sind unsicher, wie Sie mit Ihrer Immobilie am besten umgehen sollen? Sprechen Sie mich an. Gemeinsam entwickeln wir die passende Struktur – für den Unternehmenswert und Ihre persönliche Zukunft.