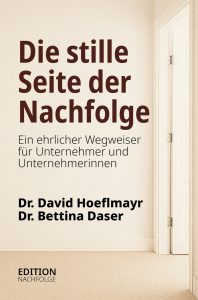Warum die Qualität der Erträge zählt
Beim Verkauf eines Unternehmens zählt für potenzielle Käufer nicht nur die Höhe des erzielten Gewinns, sondern vor allem dessen Qualität. Unter Ertragsqualität (englisch Quality of Earnings, QoE) versteht man vereinfacht gesagt, in welchem Maße der ausgewiesene Gewinn die tatsächliche wirtschaftliche Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Hohe Ertragsqualität bedeutet, dass die Gewinne konsistent, nachhaltig und durch echte operative Leistung erwirtschaftet sind – nicht durch Einmaleffekte oder kosmetische Buchungen. Geringe Ertragsqualität liegt dagegen vor, wenn der Gewinn durch ungewöhnliche oder nicht wiederkehrende Posten verzerrt wird.
Ein Käufer wird also genau hinschauen, wie zuverlässig und nachhaltig Ihre Erträge sind. Konkret prüfen Käufer im Rahmen einer QoE-Analyse oft folgende Punkte:
- Einmaleffekte: Gab es Sondereinnahmen oder -ausgaben, die den Gewinn untypisch nach oben oder unten treiben? Ein klassisches Beispiel wären staatliche Zuschüsse, ein großer Vermögensverkauf oder ein einmaliger Großauftrag, der so nicht wiederkehrt. Solche einmaligen oder nicht-operativen Posten werden in der Regel herausgerechnet, da sie kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Ertragslage sind. Das Ziel ist ein bereinigtes Bild der operativen Ertragskraft.
- Normalisierungen: Wurde der Gewinn um ungewöhnliche oder betriebsfremde Aufwendungen und Erträge bereinigt? Typische Normalisierungen sind z.B. die Anpassung eines überhöhten Geschäftsführer-Gehalts auf Marktniveau oder das Herausrechnen privater Aufwandsposten. Bei einer Transaktion werden die Erträge meist um nicht wiederkehrende Erträge/Aufwände und periodenfremde Posten bereinigt, um den nachhaltig erzielbaren Gewinn (oft EBITDA) realistisch darzustellen. Eine Sell-Side QoE-Analyse (Quality of Earnings aus Verkäufersicht) hilft Ihnen, solche Add-Backs und Anpassungen zu identifizieren und so ein normales, realitätsnahes EBITDA als Basis für die Bewertung auszuweisen.
- Cash Conversion (Ertragsqualität in Cash): Wie viel des buchhalterischen Gewinns schlägt sich tatsächlich in Liquidität nieder? Hohe Ertragsqualität spiegelt sich darin wider, dass Gewinne durch entsprechende Cashflows gedeckt sind. Wenn ein Unternehmen zwar Gewinne ausweist, aber wenig Cash generiert, läuten bei Käufern Alarmglocken. In einer QoE-Prüfung wird daher ein Proof of Cash durchgeführt – man vergleicht die ausgewiesenen Umsätze und Kosten mit den tatsächlichen Bankeingängen und -ausgängen. So wird überprüft, ob der ausgewiesene Gewinn „echt“ im Geldfluss ankommt oder ob aggressive Rechnungslegungsmethoden (z.B. vorzeitiges Erkennen von Umsätzen) die Gewinne künstlich aufgebläht haben. Ein hoher Gewinn nutzt wenig, wenn er zum großen Teil nur auf dem Papier steht.
Das Ziel all dieser Analysen ist, den wirtschaftlich realistischen Gewinn (insbesondere EBITDA) des Unternehmens bereinigt darzustellen – als Grundlage für die Unternehmensbewertung. Käufer zahlen für nachhaltig erzielbare Erträge, nicht für Schönwetter-Gewinne. Mit einer guten Ertragsqualität können Sie also einen höheren Verkaufspreis und bessere Konditionen erzielen.
Typische Prüfungspunkte einer QoE-Analyse
Im Zuge der Due-Diligence-Prüfung wird ein Käufer oder von ihm beauftragte Experten eine Quality of Earnings Analyse durchführen, um die Verlässlichkeit Ihrer Zahlen zu beurteilen. Aus Verkäufersicht sollten Sie diese Punkte proaktiv selbst prüfen, bevor es der Käufer tut. Wichtige Aspekte der Ertragsqualität sind unter anderem:
- Ertragsstruktur und Stabilität: Woher stammt Ihr Umsatz genau und wie nachhaltig ist er? Kommt der Großteil der Erlöse aus dem Kerngeschäft oder aus ungewöhnlichen Quellen? Käufer bevorzugen Erträge aus dem operativen Kerngeschäft gegenüber solchen aus einmaligen oder branchenfremden Vorgängen. Ebenso schauen sie auf die Stabilität von Umsätzen, Preisen und Margen über die letzten Jahre. Volatile, unvorhersehbare Erträge gelten als risikohaft, während konstante und vorhersehbare Gewinne ein Zeichen hoher Qualität sind. Analysieren Sie also die Umsatzentwicklung pro Produkt, Kunde oder Region und identifizieren Sie Trends. Zeigen Sie, dass Ihr Geschäftsmodell robuste und wiederkehrende Einnahmen generiert – das erhöht das Käufervertrauen in die Zukunftsfähigkeit Ihrer Gewinne.
- Normalisierungen in der GuV: Wie bereits erwähnt, müssen einmalige oder betriebsfremde Einflüsse aus Ihrer Gewinn- und Verlustrechnung eliminiert werden, um ein realistisches Bild zu zeichnen. Gehen Sie Ihre GuV durch und markieren Sie Posten, die „bereinigt“ werden müssten. Dazu zählen z.B. außerordentliche Erträge/Aufwendungen, private oder nicht betriebsnotwendige Kosten (etwa Ihr Firmenwagen, der privat genutzt wird), überhöhte Gehälter an Gesellschafter, nicht marktkonforme Mietverhältnisse mit nahe stehenden Personen, u.ä. Ziel ist eine interne bereinigte GuV, welche den nachhaltigen EBITDA ausweist. Käufer oder Investoren möchten sicherstellen, dass die gemeldeten Gewinne ohne solche Verzerrungen zustande kommen. Bereiten Sie entsprechende Unterlagen und Berechnungen vor, um diese Anpassungen plausibel darlegen zu können.
- Abhängigkeiten und Klumpenrisiken: Wie breit ist Ihr Unternehmen aufgestellt? Eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Kunden, Lieferanten oder dem Inhaber selbst wird von Käufern kritisch gesehen. Beispielsweise werden konzentrierte Umsatzquellen – wenn z.B. ein Kunde über 30% des Umsatzes ausmacht – als Risiko für künftige Gewinne bewertet. Ähnliches gilt für Lieferantenabhängigkeiten oder Vertriebskooperationen, ohne die das Geschäft leiden würde. Besonders heikel ist die Inhaberabhängigkeit: Wenn der Firmeninhaber persönlich die Schlüsselkunden betreut oder das operative Wissen hauptsächlich in seinem Kopf steckt, wirkt das Unternehmen auf Käufer fragil. Falls das Geschäft ohne Sie kaum denkbar ist, mindert das den Wert erheblich – denn nach einem Verkauf könnten Kunden abspringen oder Abläufe stocken. Identifizieren Sie daher solche Klumpenrisiken. Dokumentieren Sie Kundenstrukturen (z.B. Anteil Top-10-Kunden am Umsatz) und zeigen Sie, dass kein einzelner Wegbruch die Erträge übermäßig gefährdet. Und falls doch, entwickeln Sie Strategien, diese Abhängigkeiten zu reduzieren (mehr dazu unten).
- Working Capital und Liquidität: Erwirtschaftet Ihr Unternehmen seinen Gewinn auch tatsächlich in bar? Dabei lohnt ein Blick auf das Nettoumlaufvermögen (Working Capital) und die Liquiditätslage. Forderungen: Werden offene Kundenzahlungen zeitnah und regelmäßig eingetrieben, oder häufen sich Außenstände? Aus Sicht des Käufers haben Gewinne, die größtenteils als Forderungen in der Bilanz stehen, eine geringere Qualität – es besteht das Risiko von Ausfällen. Vorräte: Ist viel Kapital in Lagerbeständen gebunden, die eventuell abgewertet werden müssen? Überhöhte oder unverkäufliche Lagerbestände können zukünftige Abschreibungen nach sich ziehen. Verbindlichkeiten: Werden Lieferanten pünktlich bezahlt, oder finanziert das Unternehmen seinen Gewinn faktisch durch steigende Schulden bei Lieferanten? All diese Faktoren beeinflussen die Qualität der Erträge. In einer QoE-Prüfung wird der Kapitalumschlag und die Cashflow-Generierung analysiert: Potenzielle Käufer wollen sehen, dass Ihr Unternehmen das Umlaufvermögen im Griff hat und die Erträge nicht durch schlechte Liquiditätssteuerung relativiert werden. Negative Überraschungen wie Liquiditätsengpässe oder notwendige Working-Capital-Korrekturen können sonst den Kaufpreis schmälern. Stellen Sie also sicher, dass Forderungen, Vorräte und Verbindlichkeiten sauber bewirtschaftet sind. Ein nachhaltig positiver Cashflow aus dem operativen Geschäft untermauert die Ertragsqualität und beruhigt Käufer.
Warten Sie nicht auf die Käufer-Due-Diligence
Viele Unternehmer neigen dazu, abzuwarten, bis ein Käufer eine offizielle Quality of Earnings-Prüfung (im Rahmen der Due Diligence) durchführt. Dieser Ansatz ist riskant. Drehen Sie den Spieß um und nehmen Sie selbst frühzeitig die Käuferperspektive ein. Der Aufwand lohnt sich: Sie gewinnen nicht nur Klarheit über Ihre wahren Zahlen, sondern können eventuelle Baustellen noch vor den Verhandlungen beseitigen. Konkret sollten Verkäufer folgende Schritte erwägen:
- Lassen Sie Ihre Finanzzahlen aus Käufersicht prüfen: Ziehen Sie einen unabhängigen Finanzexperten oder Wirtschaftsprüfer hinzu, der Ihr Zahlenwerk einer neutralen Analyse unterzieht – quasi eine interne Due Diligence. So entdecken Sie Unstimmigkeiten oder Schwachstellen, bevor ein Käufer sie findet, und haben Zeit, diese zu korrigieren. Beispielsweise könnten dabei fehlerhafte Umsatzabgrenzungen, überhöhte Rückstellungen oder Buchhaltungsprobleme ans Licht kommen, die sich relativ leicht bereinigen lassen, aber in einer Käuferprüfung für Misstrauen sorgen würden.
- Erstellen Sie eine bereinigte interne Gewinn- und Verlustrechnung: Arbeiten Sie eine Übersicht heraus, die den bereinigten EBITDA zeigt. Darin addieren Sie alle normalisierungsbedürftigen Aufwände wieder hinzu bzw. eliminieren untypische Erträge (Stichwort Add-Backs). Diese interne GuV auf bereinigter Basis bildet die Grundlage Ihrer Wertargumentation gegenüber Interessenten. Sie demonstrieren damit Transparenz und vermitteln dem Käufer ein realistisches Bild der nachhaltigen Profitabilität. Zudem können Sie anhand dieser Zahlen schon vorab prüfen, ob Ihre Preiseinschätzung des Unternehmens (etwa ein gewünschter Multiplikator auf EBITDA) realistisch ist.
- Identifizieren Sie Risiken und Schwächen im Voraus: Gehen Sie sämtliche Bereiche Ihres Unternehmens kritisch durch – am besten so, als wären Sie selbst der Käufer. Gibt es Abhängigkeiten, die wir reduzieren müssen? Stimmt die Vertragslage mit wichtigen Kunden und Lieferanten (Kündigungsfristen, Laufzeiten etc.)? Wie robust sind unsere IT-Systeme und internen Kontrollen? Jede gefundene Schwachstelle ist eine Chance: Sie können Gegenmaßnahmen ergreifen oder sich zumindest eine schlüssige Erklärung und Lösungsstrategie zurechtlegen. Nichts ist für Käufer beruhigender, als wenn der Verkäufer auf kritische Nachfragen souverän antworten kann: „Ja, das Thema ist uns bekannt, und wir haben bereits X und Y unternommen, um es zu adressieren.“ So nehmen Sie Wind aus den Segeln möglicher Verhandlungenachlässe.
- Bereiten Sie sich auf Detailfragen vor: Eine gründliche QoE-Prüfung durch Käuferanwälte oder -berater bringt oftmals eine Flut an Nachfragen mit sich. Simulieren Sie dieses Szenario bereits intern. Überlegen Sie, welche Fragen zu Ihren Zahlen, Prozessen oder Verträgen kommen könnten, und stellen Sie die nötigen Unterlagen zusammen. Beispielsweise: Können Sie jeden größeren Umsatzsprung erklären? Haben Sie Belege dafür, dass gewisse Kosten einmalig waren und künftig nicht anfallen? Wie ist die Deckungsbeitragsstruktur nach Produktgruppen? Je besser Sie hier vorbereitet sind, desto souveräner wirken Sie im Prozess – was wiederum Vertrauen schafft. Ein gut vorbereiteter Verkäufer strahlt Professionalität aus und lässt Käuferseite spüren, dass es wenig Spielraum für negative Überraschungen gibt. Das erhöht letztlich die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen und zügigen Verkaufsabschlusses.
Nutzen Sie verbleibende Zeit, um die Ertragsqualität zu steigern
Zwischen dem Entschluss, die Firma zu verkaufen, und dem tatsächlichen Verkaufsprozess vergeht idealerweise einige Zeit. Nutzen Sie diese strategisch, um Ihr Unternehmen für die Übergabe noch attraktiver zu machen – insbesondere was die Qualität der Erträge angeht. Hier ein paar Ansatzpunkte, die Ihren Betrieb aus Käufersicht solider dastehen lassen:
- Abhängigkeiten reduzieren: Diversifizieren Sie Ihren Kundenstamm und Ihre Lieferantenbasis. Wenn z.B. aktuell ein oder zwei Großkunden den Löwenanteil Ihres Umsatzes ausmachen, versuchen Sie, neue Kunden zu gewinnen oder den Umsatzanteil ausgewogener zu verteilen. Ebenso sollten Sie Know-how und Beziehungen, die bislang nur beim Inhaber liegen, auf mehrere Schultern verteilen. Führen Sie klare Stellvertreter-Regelungen ein, bauen Sie ein Management-Team auf und dokumentieren Sie wichtige Prozesse, sodass das Unternehmen auch ohne Ihre persönliche Präsenz reibungslos läuft. Jede reduzierte Inhaberabhängigkeit steigert die Attraktivität für Käufer und kann sich wertsteigernd auszahlen.
- Sondereffekte und Privilegien bereinigen: Entfernen Sie rechtzeitig alle nicht betriebsnotwendigen Verflechtungen. Das können private Ausgaben sein, die über die Firma liefen (Firmenwagen, -wohnung, Reisen), oder Vergünstigungen, die bestimmten Personen gewährt werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen „clean“ und unabhängig dasteht – also keine ungewöhnlichen Vertragskonditionen mit nahe stehenden Personen, keine verdeckten Gewinnausschüttungen oder komplizierten Beteiligungsstrukturen, die Misstrauen schüren könnten. Falls Ihr Unternehmen in der Vergangenheit von einmaligen Effekten profitiert hat (z.B. ein gerichtlicher Vergleich, ein Steuererlass), sollten Sie diese Effekte klar ausweisen und für die Zukunft herausrechnen. Je transparenter und bereinigter Ihre Finanzhistorie, desto leichter tut sich der Käufer, an Ihre Zahlen zu glauben.
- Prozesse strukturieren und dokumentieren: Eine hohe Ertragsqualität geht Hand in Hand mit geordneten, nachvollziehbaren Geschäftsabläufen. Überarbeiten Sie Ihre internen Prozesse im Hinblick auf Skalierbarkeit und Robustheit. Gibt es schriftlich fixierte Ablaufpläne für Kernprozesse (vom Vertrieb bis zur Produktion)? Sind Zuständigkeiten klar geregelt? Ein Unternehmen mit sauberen Abläufen und Kontrollen erzielt seine Gewinne in der Regel verlässlicher und reproduzierbarer. Außerdem verringern dokumentierte Prozesse die Abhängigkeit von einzelnen Köpfen und erleichtern dem Käufer die Übernahme. Investieren Sie in dieser Vorbereitungsphase also ruhig Zeit in Organisationsentwicklung – es signalisiert Professionalität und vermindert operative Risiken.
- Nachhaltige Margensicherung betreiben: Prüfen Sie Ihr Geschäftsmodell auf Preissetzung und Kostenstruktur. Können Sie Preissteigerungen bei wichtigen Inputfaktoren weitergeben? Haben Sie Langfrist-Verträge mit Kunden oder Lieferanten, die Stabilität bringen? Entwickeln Sie – falls noch nicht geschehen – Preismodelle oder Serviceverträge, die wiederkehrende Umsätze und stabile Margen sichern. Ziel ist, dem Käufer zu zeigen, dass Ihre Profitabilität nicht leicht wegzuerodern ist. Beispielsweise können Abo- oder Wartungsverträge im Produktportfolio für kontinuierliche Einnahmen sorgen. Oder bauen Sie variable Kostenanteile aus, um Flexibilität zu erhöhen. Jede Maßnahme, die die Nachhaltigkeit Ihrer Gewinnmarge untermauert, verbessert letztlich die Qualität der Erträge.
Fazit: Qualität zahlt sich aus
Je besser die Qualität Ihrer Erträge, desto stärker ist Ihre Verhandlungsposition beim Unternehmensverkauf. Wenn Ihre Finanzzahlen belastbar, nachvollziehbar und nachhaltig sind, steigen die Vertrauen und Zahlungsbereitschaft der Käufer. Sie haben dann handfeste Argumente für einen höheren Kaufpreis und zugleich weniger Angriffsfläche bei Preisverhandlungen. Eine frühzeitig und gründlich vorbereitete Quality-of-Earnings-Analyse wirkt dabei wie ein Sicherheitsgurt: Sie verhindert zwar keinen „Unfall“ – also unerwartete Fragen oder schwierige Verhandlungen – aber schützt Sie im entscheidenden Moment. Mit anderen Worten: Eine hohe Ertragsqualität kann zwar den Verkaufsprozess nicht vollständig risikofrei machen, aber sie federt die größten Risiken ab und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihr Unternehmen erfolgreich und zu optimalen Konditionen verkaufen. In diesem Sinne: Nutzen Sie die Zeit vor dem Verkauf, bringen Sie Ihre Ertragsqualität auf Vordermann – und gehen Sie gut gerüstet in die Verhandlungen!