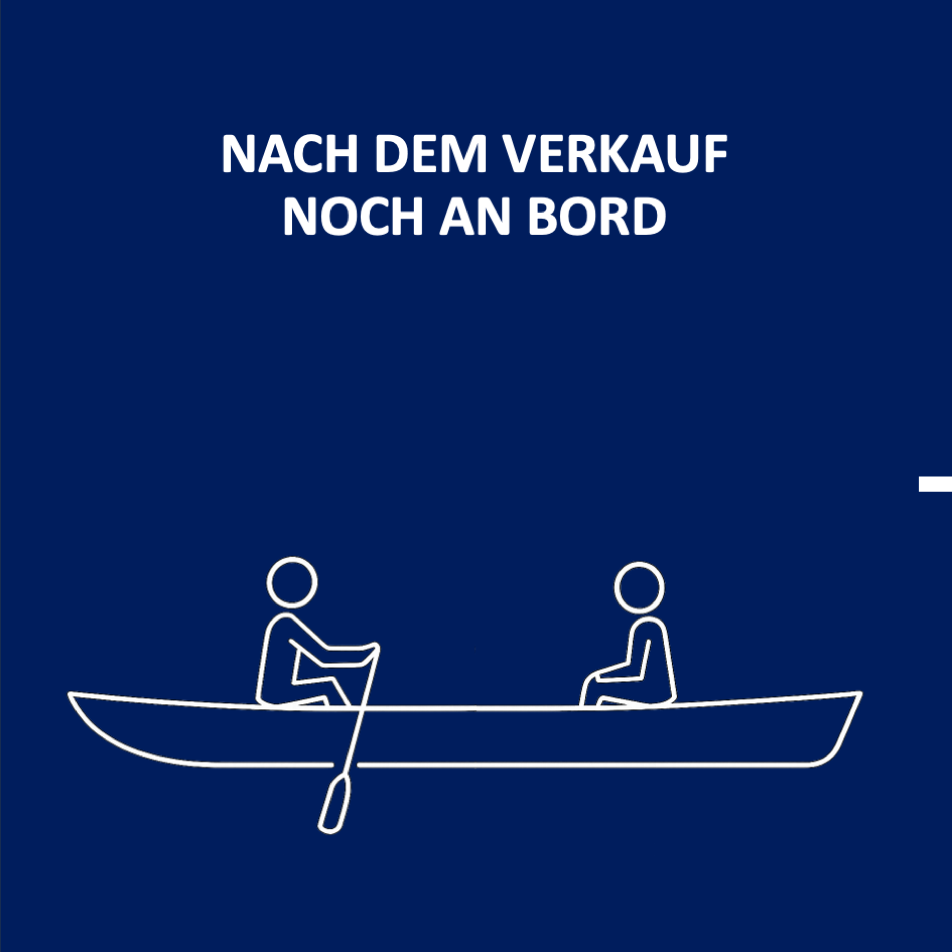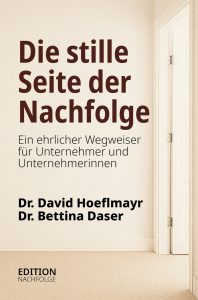Viele Käufer von Unternehmen wünschen sich, dass der bisherige Inhaber auch nach der Übergabe weiterhin mit an Bord bleibt. Das schafft Vertrauen bei den neuen Eigentümern, Mitarbeitern und Kunden und reduziert wahrgenommene Risiken beim Übergang. Für Sie als Verkäufer eines Unternehmen kann dieses Mitgehen nach dem Verkauf reizvoll sein – schließlich kennen Sie Ihr Unternehmen in- und auswendig und können weiterhin von dessen Erfolg profitieren. Gleichzeitig birgt es aber auch Gefahren: Je nach Ausgestaltung kann ein Teil Ihres Kaufpreises oder Vermögens an die künftige Entwicklung des Unternehmens geknüpft sein, ohne dass Sie noch die volle Kontrolle haben. Deshalb kommt es entscheidend darauf an, unter welchen Bedingungen und in welcher Rolle man als Verkäufer beteiligt bleibt.
Es gibt verschiedene Modelle, wie Verkäufer nach dem Unternehmensverkauf finanziell oder operativ eingebunden bleiben können. In der Praxis haben sich vor allem drei typische Varianten etabliert, die ein Käufer vorschlagen kann: Earn-Out, Rückbeteiligung (Minderheitsbeteiligung des Verkäufers) und Verkäuferdarlehen. Jede dieser Varianten hat ihren eigenen Charme – aber auch spezifische Risiken. Im Folgenden beleuchten wir diese drei Modelle näher, erklären Vor- und Nachteile aus Verkäufersicht und geben Tipps, worauf Sie als Verkäufer unbedingt achten sollten. Zum Schluss schauen wir uns zudem Alternativen an, bei denen Sie weiter an Bord bleiben können, allerdings mit deutlich geringerem finanziellem Risiko, etwa in beratender Funktion oder als Beirat.
Earn-Out – Erfolg mit Bedingungen
Ein Earn-Out ist ein erfolgsabhängiger Teil des Kaufpreises, der erst nach dem Unternehmensverkauf ausgezahlt wird – und zwar nur, wenn bestimmte vertraglich festgelegte Ziele erreicht werden. Mit anderen Worten: Der Käufer zahlt Ihnen zunächst einen festen Basiskaufpreis und einen weiteren Betrag unter Bedingungen. Typische Zielgrößen für Earn-Out-Klauseln sind etwa die Umsatzentwicklung oder das Erreichen eines definierten Gewinnziels (z. B. ein bestimmtes EBITDA) in ein bis drei Jahren nach der Übergabe. Entwickelt sich das Unternehmen in dieser definierten Periode wie vereinbart (oder besser), erhalten Sie als Verkäufer nachträglich den variablen Kaufpreisanteil. Bleiben die Ergebnisse hinter den Zielen zurück, verringert sich die Zahlung oder entfällt komplett – je nach Ausgestaltung der Vereinbarung.
Aus Käufersicht bietet ein Earn-Out Sicherheit: Er muss einen Teil des Kaufpreises erst bezahlen, wenn das Unternehmen den erwarteten Erfolg tatsächlich bringt. Für den Verkäufer kann ein Earn-Out attraktiv sein, weil er die Chance bietet, einen höheren Gesamtpreis zu erzielen – vorausgesetzt, das Unternehmen performt nach dem Verkauf gut. Gerade wenn Sie überzeugt sind, dass Ihr Unternehmen in Zukunft wachsen wird, können Sie durch einen Earn-Out an diesem Wachstum finanziell teilhaben, selbst nachdem Sie die Mehrheit oder Kontrolle abgegeben haben.
Allerdings ist ein Earn-Out mit erheblichen Risiken verbunden. Das größte Risiko liegt darin, dass Sie als Verkäufer nach der Übergabe kaum noch Einfluss auf die Geschäfte haben, aber dennoch von deren Erfolg abhängig sind. Der Käufer oder neue Geschäftsführer trifft die Entscheidungen und könnte – bewusst oder unbewusst – Maßnahmen ergreifen, die die Earn-Out-Kennzahlen drücken. Beispielsweise könnten verstärkte Investitionen, höhere Abschreibungen oder veränderte Kostenansätze das EBITDA schmälern, wodurch das Erreichen der Earn-Out-Ziele schwieriger wird. In ungünstigen Fällen entsteht ein Konflikt: Der Käufer hat eventuell einen Anreiz, die Messlatte für den Earn-Out nicht zu hoch zu legen, um weniger zahlen zu müssen. Als Verkäufer stehen Sie dann nahezu machtlos daneben, wenn die vereinbarten Ziele verfehlt werden.
Tipp für Verkäufer: Lassen Sie sich auf einen Earn-Out nur ein, wenn die Spielregeln klar definiert sind. Achten Sie darauf, die relevanten Kennzahlen eindeutig und manipulationssicher im Kaufvertrag zu regeln. „Manipulationssicher“ bedeutet, dass die Berechnung der Kennzahl klar beschrieben ist (z. B. welche Erlöse genau zählen, welche Kosten abgezogen werden etc.), damit nachträgliche Änderungen in der Bilanzierung oder Buchhaltung das Ergebnis nicht verfälschen. Außerdem sollten Sie – falls möglich – vertraglich Einflussrechte im Earn-Out-Zeitraum festschreiben. Das könnte bedeuten, dass Sie für die Dauer des Earn-Outs eine beratende Funktion im Management übernehmen oder bei bestimmten Entscheidungen ein Mitspracherecht haben. So können Sie zumindest teilweise steuern, dass die Zielvorgaben realistisch erreicht werden. Schließlich ist es ratsam, die Earn-Out-Periode zeitlich eher kurz zu halten (z. B. 1–2 Jahre), um lange Unsicherheitsphasen zu vermeiden und schneller Klarheit über den endgültigen Kaufpreis zu bekommen.
Rückbeteiligung – Gemeinsam investieren
Bei der Rückbeteiligung bleibt der Verkäufer mit einem Minderheitsanteil am Unternehmen beteiligt. Das heißt, Sie verkaufen zwar den Großteil Ihrer Firmenanteile, aber rollen einen Teil des Erlöses wieder ins Unternehmen zurück oder behalten einen Anteil. Häufig liegen solche Rückbeteiligungen im Bereich von etwa 10 % bis 40 % des Unternehmens, je nach Verhandlung und Vertrauen zwischen den Parteien. Effektiv werden Sie damit zum Mitgesellschafter des Käufers (bzw. dessen Erwerbsvehikel) und investieren gemeinsam in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.
Der große Vorteil einer Rückbeteiligung aus Verkäufersicht ist die Möglichkeit, an einer weiteren Wertsteigerung des Unternehmens teilzuhaben. Wenn der neue Mehrheitseigentümer – sei es ein strategischer Käufer oder ein Finanzinvestor – das Unternehmen in den kommenden Jahren erfolgreich weiterentwickelt, steigt der Unternehmenswert. Ihr verbliebener Anteil könnte bei einem späteren Verkauf (Exit) oder durch Gewinnausschüttungen zusätzliches Kapital in Ihre Kasse spülen. Kurz gesagt: Sie geben zwar jetzt nicht 100 % ab, profitieren dafür aber potenziell von einem zweiten Zahltag in der Zukunft. Dieses Modell bietet sich oft an, wenn Käufer und Verkäufer optimistisch sind, dass noch „Luft nach oben“ für das Unternehmen besteht, und beide Seiten vom zukünftigen Erfolg profitieren wollen.
Mit der Chance kommt jedoch auch hier ein Risiko: Als Minderheitsgesellschafter haben Sie in der Regel keine Kontrolle mehr über das operative Geschäft. Die Macht liegt beim Mehrheitseigentümer. Entscheidungen können getroffen werden, denen Sie vielleicht nicht zustimmen – von der strategischen Ausrichtung bis hin zur Verwendung von Gewinnen. Im schlimmsten Fall entwickelt sich das Unternehmen unter der neuen Führung schlechter als erwartet, und Ihr verbliebener Anteil verliert an Wert oder wird im Extremfall gar wertlos. Zudem bleiben Sie trotz geringerer Beteiligung weiterhin Mitunternehmer mit allen Pflichten und potenziellen Haftungsrisiken, aber ohne die früheren Einflussmöglichkeiten. Dieses Ungleichgewicht kann frustrierend sein, wenn Sie zusehen müssen, wie Ihr ehemaliges Unternehmen möglicherweise anders geführt wird, als Sie es für richtig halten.
Tipp für Verkäufer: Bevor Sie einer Rückbeteiligung zustimmen, verhandeln Sie klare Bedingungen für Ihren Ausstieg und Ihre Rechte als Minderheitsgesellschafter. Klären Sie mit dem Käufer die geplante Haltefrist und Exit-Strategie: Wie lange plant der neue Mehrheitseigentümer, das Unternehmen zu halten? Ist in einigen Jahren ein Weiterverkauf oder Börsengang vorgesehen? Je besser Sie die Timeline kennen, desto realistischer können Sie Ihre Erwartungen steuern. Sichern Sie sich vertraglich Mitverkaufsrechte (Tag-along-Rechte), damit Sie bei einem zukünftigen Verkauf Ihres Anteils zu denselben Konditionen mitverkaufen dürfen und nicht dauerhaft „festhängen“. Ebenso wichtig: Schützen Sie Ihre Minderheitsrechte in Bezug auf Information und finanzielle Beteiligung. Das bedeutet z. B., dass Dividenden oder Gewinnausschüttungen fair und anteilig erfolgen sollten und Sie ein Recht auf transparente Berichte zur Unternehmensentwicklung haben. In einer Gesellschaftervereinbarung können beispielsweise Zustimmungsrechte für wichtige Entscheidungen, Auskunftsrechte oder Vorkaufsrechte festgelegt werden. So stellen Sie sicher, dass Sie trotz Minderheitsposition angemessen berücksichtigt werden und im Ernstfall Ihre Investition nicht schutzlos den Entscheidungen anderer ausgeliefert ist.
Verkäuferdarlehen – Der stille Partner
Ein Verkäuferdarlehen (auch „Vendor Loan“ genannt) bedeutet, dass ein Teil des Kaufprezes vom Käufer nicht sofort bezahlt, sondern dem Verkäufer als Darlehen gestundet wird. Praktisch funktioniert es so: Sie einigen sich mit dem Käufer auf einen Gesamtpreis, doch anstatt diesen vollständig bei Closing (Vertragsabschluss) zu zahlen, stunden Sie dem Käufer einen bestimmten Betrag. Dieser ausstehende Teil wird über einen festgelegten Zeitraum zurückgezahlt – meist verzinst – ähnlich wie ein Kredit, den Sie dem neuen Eigentümer gewähren. In der Übergangszeit sind Sie quasi ein stiller Financier des Unternehmens: Sie treten nicht mehr aktiv in Erscheinung, haben aber noch Geld im Unternehmen „stecken“, das Sie vom Käufer zurückerwarten.
Der Vorteil eines Verkäuferdarlehens liegt zunächst darin, dass es den Deal überhaupt ermöglichen kann. Gerade bei mittelständischen Unternehmen kommt es vor, dass ein Käufer – etwa ein familieninterner Nachfolger oder ein MBO-Team – nicht den kompletten Kaufpreis auf einmal stemmen kann oder will. Durch das Verkäuferdarlehen leisten Sie einen Beitrag zur Finanzierung der Übernahme. Dadurch wird der Verkauf für den Käufer finanzierbar, ohne dass dieser sein Angebot drastisch senken muss. Für Sie als Verkäufer bedeutet es, dass der Verkauf zustande kommt und Sie zumindest einen Großteil Ihres Kapitals sofort erhalten, während ein Restbetrag später folgt. Ein weiterer Pluspunkt: Das Darlehen wird verzinst. Sie erhalten also laufend Zinszahlungen, die Ihre Gesamterlöse steigern können – quasi ein zusätzliches „Gewinnhäppchen“ für Ihre Geduld.
Das Risiko eines Verkäuferdarlehens besteht allerdings darin, dass Sie zum Gläubiger Ihres eigenen, ehemals betriebenen Unternehmens werden – und damit dem Kreditausfallrisiko ausgesetzt sind. Falls das Unternehmen in der Rückzahlungsphase in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät, kann es passieren, dass der Käufer das Darlehen nicht planmäßig bedienen kann. Im schlimmsten Fall droht ein Ausfall: Sie würden den gestundeten Betrag ganz oder teilweise verlieren. Dieses Risiko ist insbesondere dann erhöht, wenn das Verkäuferdarlehen nachrangig gegenüber Bankdarlehen vereinbart wurde, was in der Praxis häufig der Fall ist. „Nachrangig“ bedeutet, dass im Insolvenzfall erst die Banken und andere vorrangige Gläubiger bedient werden und Ihr Anspruch hintansteht. Zudem haben Sie als stiller Partner keine direkte Kontrolle mehr über die Geschäftsentwicklung, können also Probleme im Unternehmen nicht selbst beheben. Unterm Strich tragen Sie einen Teil des Finanzierungsrisikos der Übernahme mit.
Tipp für Verkäufer: Wenn Sie ein Verkäuferdarlehen gewähren, achten Sie auf klare Rückzahlungsmodalitäten. Legen Sie vertraglich fest, über welchen Zeitraum und in welchen Raten das Darlehen zurückgezahlt wird und wie hoch der Zinssatz ist. Üblich sind Laufzeiten von z. B. 3–5 Jahren, doch wichtiger als die Dauer ist die Transparenz: Wann fließen die ersten Zahlungen? Gibt es tilgungsfreie Anlaufzeiten? Solche Details sollten keinen Spielraum für Interpretationen lassen. Prüfen Sie zudem den Rang und eventuelle Sicherheiten Ihres Darlehens. Wenn möglich, verhandeln Sie, nicht komplett unbesichert dazustehen – etwa durch nachträgliche Besicherungen oder zumindest ein Schuldanerkenntnis des Käufers. In der Praxis sind Verkäuferdarlehen zwar oft nachrangig und ohne dingliche Sicherheiten, aber ein offenes Gespräch darüber kann nicht schaden. Schließlich sollten Sie sich überlegen, ob Sie weiterhin involviert bleiben (z. B. als Berater in der Übergangszeit), um ein Auge auf die Entwicklung zu haben. Je mehr Sie über die Unternehmenslage im Bilde sind, desto eher können Sie reagieren, falls sich Schwierigkeiten abzeichnen.
Alternative Rollen mit geringem finanziellem Risiko
Nicht jeder Verkäufer möchte sein Geld im Unternehmen lassen oder vom zukünftigen Erfolg abhängig machen – und das muss er auch nicht. Es gibt Alternativen, wie Sie nach dem Verkauf noch an Bord bleiben können, ohne erhebliche finanzielle Risiken einzugehen. Zwei klassische Beispiele sind die Beraterrolle und die Beiratsrolle im Unternehmen nach der Übergabe.
In einer Beraterrolle bleiben Sie dem Unternehmen als externer Consultant verbunden. Häufig wird vertraglich vereinbart, dass der ehemalige Eigentümer für eine bestimmte Zeit (z. B. ein oder zwei Jahre) dem neuen Management mit Rat und Tat zur Seite steht. Dies kann auf Stundenbasis, mit einem monatlichen Honorar oder projektbezogen erfolgen. Der Vorteil: Sie tragen kein finanzielles Risiko mehr bezüglich des Kaufpreises – Ihr Geld haben Sie vollständig erhalten (bis auf eventuelle erfolgsabhängige Komponenten, falls solche vereinbart wurden) – und agieren nur noch als Wissens- und Erfahrungsträger. Der Käufer schätzt Ihre Expertise, und Sie helfen, Kundenbeziehungen, Lieferantenkontakte und Know-how reibungslos zu übergeben. Als Berater können Sie dem Unternehmen Stabilität geben, ohne dass Ihre eigene finanzielle Absicherung auf dem Spiel steht. Wichtig ist, den Umfang und die Dauer der Beratung klar zu definieren, damit keine Unklarheiten über Verantwortlichkeiten entstehen. Auch sollte geklärt sein, in welchen Bereichen Ihr Rat gefragt ist und wie die Kommunikation mit der neuen Führung abläuft, um Missverständnisse zu vermeiden.
Eine Beiratsrolle (oder bei entsprechender Firmengröße ein Aufsichtsratsmandat) ist eine weitere Möglichkeit. Viele mittelständische Unternehmen richten für die Nachfolge einen Beirat ein, in dem der ehemalige Unternehmer einen Sitz erhält. In dieser Position wirken Sie als strategischer Impulsgeber und stehen dem Unternehmen beratend auf höherer Ebene zur Seite, statt im täglichen Operativen mitzuwirken. Der Beirat trifft sich in regelmäßigen Abständen, überwacht die Unternehmensentwicklung und gibt Empfehlungen, hat aber meist keine operative Entscheidungsbefugnis. Für Sie als Verkäufer ist dies attraktiv, weil Sie weiterhin ein Auge auf „Ihr Lebenswerk“ haben können und Ihre Erfahrung einbringen dürfen – jedoch ohne nochmals finanziell in die Firma investieren zu müssen. Zudem signalisiert ein solcher Beiratsposten Kontinuität nach außen: Geschäftspartner und Mitarbeiter sehen, dass Sie dem Unternehmen verbunden bleiben, was Vertrauen schafft. Gleichzeitig ist Ihr finanzielles Risiko minimal, da Ihr Engagement vor allem ideeller und beratender Natur ist (verbunden höchstens mit einer Vergütung für die Beiratstätigkeit, aber keinem eigenen Kapital auf dem Spiel).
Beide Modelle – Beratervertrag und Beiratsmandat – ermöglichen es, „mitzugehen“ ohne mitzuzahlen. Sie sind besonders dann sinnvoll, wenn der Käufer vor allem an Ihrem Know-how und Ihrem Netzwerk interessiert ist, nicht an Ihrem Kapital. Natürlich können solche Rollen auch mit den oben genannten finanziellen Instrumenten kombiniert werden. Beispielsweise ist es nicht unüblich, dass ein Verkäufer bei einem Earn-Out zusätzlich als Berater für die Dauer der Earn-Out-Periode im Unternehmen bleibt, um aktiv zum Erfolg beizutragen. Wichtig ist jedoch, klare Grenzen und Erwartungen festzulegen: In welcher Rolle sind Sie tätig, wem berichten Sie, und wie weit reicht Ihr Einfluss? So vermeiden beide Seiten Konflikte und Missverständnisse.
Fazit
Mitgehen kann klug sein – wenn die Regeln klar sind. Wenn Sie Ihr Unternehmen verkaufen, kann das An-Bord-Bleiben in irgendeiner Form für alle Beteiligten Vorteile bringen: Der Käufer fühlt sich sicherer, das Unternehmen profitiert weiter von Ihrem Wissen, und Sie haben die Chance auf zusätzlichen Ertrag oder eine sanftere Übergabe. Entscheidend ist jedoch, dass Sie nicht blind dem Ruf des Käufers folgen, „doch noch mit drin zu bleiben“. Jedes der finanziellen Modelle – ob Earn-Out, Rückbeteiligung oder Verkäuferdarlehen – will gut durchdacht und vertraglich sauber gestaltet sein. Legen Sie Wert auf transparente Kriterien, faire Einflussmöglichkeiten und eine ausgewogene Verteilung von Chancen und Risiken. Und bedenken Sie: Es muss nicht immer das große finanzielle Risiko sein. Auch in einer beratenden oder überwachenden Funktion können Sie nach dem Verkauf wertvoll mitwirken, ohne Ihre finanzielle Sicherheit zu gefährden. Letztlich kommt es auf das Zusammenspiel von Rolle, Rechten und Risiken an. Wenn Sie diese Komponenten in Einklang bringen, steht einer erfolgreichen Zusammenarbeit nach dem Verkauf – zum Nutzen beider Seiten – nichts im Wege.